Am 14. März 2003 verkündete der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 die wohl einschneidensten Sozialreformen die die Bundesrepublik Deutschland bis dahin erfahren hatte unter dem eher verharmlosenden Begriff Arbeitsmarktreformen. Ergebnis war ein großer Sozialabbau in der Bundesrepublik.
Aller Anfang ist verwirrend
Angetreten war die erste rot-grüne Koalition 1998 mit dem Versprechen, den sogenannten Reformstau zu beenden; so sollte z.B. die Vermögenssteuer wieder eingeführt und der demographische Faktor bei der Rente (eine Nebelkerze für Kürzungen) wieder abgeschafft werden.
Stattdessen gab es einen Paradigmenwechsel bei den sozialen Standards. Kernpunkt war die Einführung des Arbeitslosengeld II. Zum 01.01.2005 erfolgte ein gravierender Einschnitt in die sozialen Sicherungssysteme. Ergebnis war ein dramatisch wachsendes Armutsrisiko für breite Bevölkerungsschichten, begleitet von staatlich gefördertem Lohndumping.
Armutsrisiko, weil Arbeitnehmer*innen innerhalb von 12-18 Monaten auf Sozialhilfeniveau landeten und zunächst Erspartes wie Lebensversicherungen aufzehren mussten.
Dies ging einher mit der Vermarktwirtschaftlichung des Bildungssystems. Der Staat greift ein, aber mit veränderten Schwerpunkten: Weniger sozial aber mehr verwertbare Bildungs- und Forschungsaufgaben.
Schon während der Ära Kohl begann die Umdeutung des Reformbegriffs. So sprach die FDP gerne von „wirklichen Reformen“.
Nun wurde mittelfristig das Arbeitsvolumen jedes Arbeitnehmers erhöht und die Bezahlung der geleisteten Arbeit gesenkt. Die Gewerkschaften hatten den zahlreichen Initiativen von Unternehmerverbänden (Initiative neue soziale Marktwirtschaft; Konvent für Deutschland) offenbar nichts entgegenzusetzen und konnten auch die Medien zur Vermittlung ihrer Position nicht nutzen. Ohne eine glaubwürdige öffentliche Kommunikation der Gewerkschaften konnte diese Reform den öffentlichen Raum beherrschen.
Bürgergeld und Aktienrente: Zeitenwende – Wendezeit?
Die Agenda 2010 war nicht mit einem neuen Wohlstandsversprechen verbunden à la „Wohlstand für alle“, der sozialen Marktwirtschaft. Es ging und geht aber nach wie vor darum, den Wohlstand gerechter zu verteilen und soziale Konflikte zu befrieden.
Die Umdeutung der Begriffe wird fortgesetzt mit dem „Bürgergeld“, welches letztlich nur verschleiert, dass es sich um alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Der Bürger bekommt 50 Euro im Monat mehr, er wird dadurch aber nicht zu einem erfolgreichen Marktteilnehmer und seine Kaufkraft aufgrund der Inflationsrate nicht verbessert.
Eine weitere fragwürdige Bezeichnung ist die Aktienrente. Hier wird ein Begriff aus der Finanzwirtschaft „Aktie“ mit einem sozialen „Rente“ gekoppelt; der Markt hat eigentlich bisher gezeigt, dass er nicht der große Regler ist, als der er immer dargestellt wird. Warum also nur die Ausgaben erhöhen, anstatt zuerst einmal die Einnahmen zu verbessern, z.B. indem auch Beamte in die Rentenversicherung einzahlen?
Die Ideologie des Marktes besagt noch immer: es wird alles über den Preis geregelt. Über den individuellen Konsum wird im Kapitalismus zunehmend die richtige politische Haltung signalisiert, denn der Geldbeutel wird mit Demokratie verwechselt.
Folgerichtig ist das Ergebnis der Agenda: Die Kaufkraft großer Teile der Bevölkerung wurde zugunsten von Gewinnen und Vermögen geschrumpft und das Vertrauen in Demokratie gleich mit, über die Auswirkungen einer Aktienrente kann nur spekuliert werden.
Auch heute sind wieder SPD und Grüne mit an der Regierung und hätten also die Chance, vergangene Fehler zu korrigieren. Die Agenda 2010 mit all ihren Fehlentwicklungen wäre einer davon. Nur zu, macht mal!

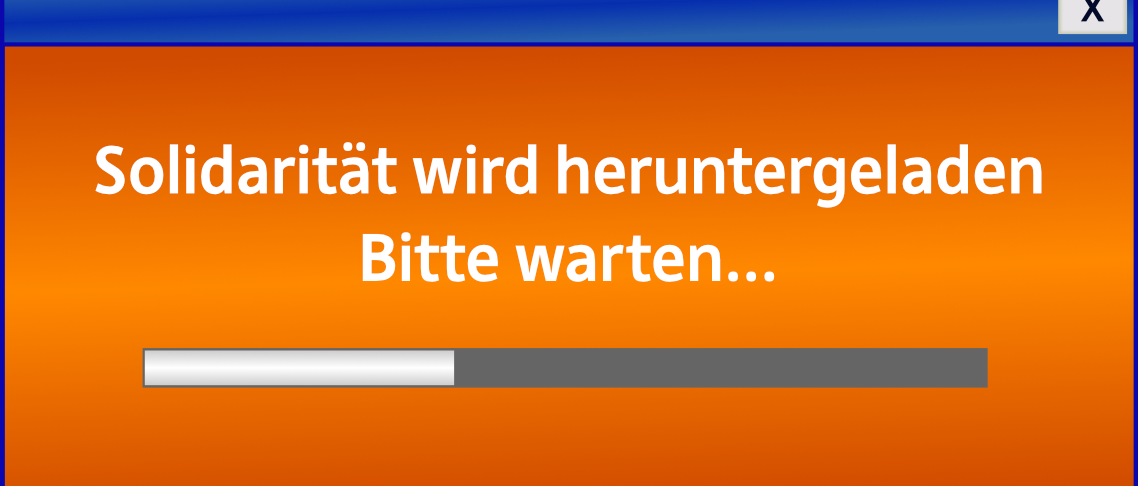
So ist es. Das war/ ist Armut per Gesetz. Von der SPD. Und Bildung zählt nicht. Denn man landet immer bei HARTZ IV, auch wenn man Dr. Ist. Habe mal eine zweifache Doktorin auf dem JobCenter Pankow getroffen.
Und was immer mehr hinzu kommt, die Ämter und Behörden, sogar die Deutsche Rentenversicherung hält sich die Bürokratie gerne vom Leibe.
Die Betroffenen erhalten nicht mal das Wenige was ihnen laut Gesetz zusteht. Und es gibt keine Möglichkeit gegen die Willkür der Behörden vorzugehen. Selbst das Sozialgericht spielt seit den letzten Jahren mit. Und die Richter wissen oft selbst nicht Bescheid.
Das ist unserer „Rechtsstaat“. Die UNO hat im Dezember 2018 die BRD wegen ihres schlechten Sozialstaates scharf gerügt. Da ging ein Aufschrei und große Diskussion durch unsere Presse. Könnt Euch sicher erinnern? Nein?
Und eine DIW Studie erbrachte 2019 das 550 000 arme Rentner keine Grundsicherung im Alter erhalten, obwohl diese Ihnen zustünde. So spart der Staat jährlich etwa 2 Mrd.
Überall wo man Anträge stellen muss erhält man nix. Weil die Menschen in den Behörden diese nicht bearbeiten mögen, den Menschen, die sie stellen müssen, der Aufwand zu hoch ist.
Die Deutsche Rentenversicherung hat 1200,00€ meiner Rentenbeiträge unterschlagen. Und wollte dann noch 700,00 € von mir dazu haben, obwohl sie mir seit 2017 eigentlich etwas zurück erstatten muss. Darum kämpfe ich jetzt bereits 6 Jahre. Und die Bearbeiterin betrügt weiter. Sie hat jetzt ein halbes Jahr für eine Antwort gebraucht. Lügen zu konstruieren ist eben aufwendig. Zum Glück hat das jetzt der 2. Sozialrichter sofort selbst erkannt (der erste wusste es nicht), und nun überzeugt mal einen Richter von der Gesetzeslage, die er nicht begreift.
Schwierig. Auch mein Anwalt hat es nicht kapiert, was immer noch zu meinem Nachteil gelogen ist, bei der Neubescheidung.
Wir bräuchten Bürgeranwälte nachdem Vorbild von Österreich, die sich kostenlos bei den Behörden für die Belange der Betroffenen einsetzen. Alles andere ist eine sehr teure Arbeitsbeschaffungsmassnahme für Juristen. Glaube die Anzahl der Juristen und Kammern beim Sozialgericht Berlin hat sich seit HARTZ IV verdreifacht. Und noch ein Novum sie Richter wimmeln sich Verfahren jetzt gerne mit konstruierten Verfahrensfehlern ab. Stichwort Fristversämniss u.ä.
Nicht kurz eine Info. HARTZ Kommission hat 2005 schon 504 € Regelsatz vorgeschlagen, nicht 345€ den wir damals erhalten haben.
Heute müssten wir bei 800€ liegen (ohne Inflation).
Tschüss Euch marsupimami